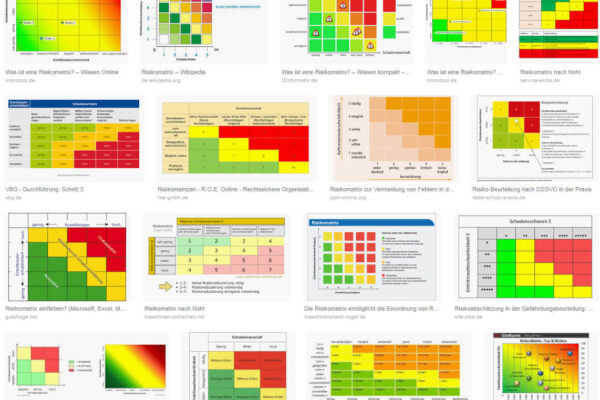Worst-Case vs. Best-Case: Entscheidungskraft durch Szenarien stärken
Entscheidungsstärke gehört zu den wichtigsten Soft Skills – besonders für Menschen in Führungspositionen, im Projektmanagement oder als Unternehmer. Doch nicht jeder fällt Entscheidungen mit Leichtigkeit. Gerade bei weitreichenden Entscheidungen kommt es schnell zu Unsicherheiten, Entscheidungsaufschub oder gar Blockaden. Eine praxiserprobte Methode, um mehr Klarheit und Sicherheit in den Entscheidungsprozess zu bringen, ist die sogenannte Worst-Case-/Best-Case-Methode. Sie beruht auf Elementen der Szenariotechnik, wie man sie aus dem Risikomanagement kennt, und hilft dabei, gedanklich ein Spektrum möglicher Konsequenzen zu durchdenken. Vgl.: Szenariotechnik / Szenariobildung.
Was steckt hinter der Worst-Case-/Best-Case-Methode?
Bei dieser Methode geht es darum, für eine bevorstehende Entscheidung zwei gegensätzliche Szenarien zu entwickeln:
- Worst-Case-Szenario: Was ist das Schlimmste, was passieren könnte?
- Best-Case-Szenario: Was wäre das bestmögliche Ergebnis?
Optional kann zusätzlich ein „Realistic Case“ – also ein mittleres Szenario – ergänzt werden. Der Fokus liegt aber darauf, sich mit den beiden Extrempunkten auseinanderzusetzen, um die eigene emotionale Blockade zu überwinden und rationale Klarheit zu gewinnen.
Ziel ist es, eine fundierte Grundlage zu schaffen, auf der man die Tragweite einer Entscheidung besser beurteilen kann. Gleichzeitig wird die Entscheidungsfreude gestärkt, weil Unsicherheiten reduziert werden.
Warum diese Methode funktioniert
In der Szenarioanalyse arbeitet man gezielt mit gedanklichen Modellen, um mögliche Entwicklungen zu simulieren. Diese Vorgehensweise wird nicht nur im Risikomanagement eingesetzt, sondern auch in der Strategieberatung, im Coaching oder in der Persönlichkeitsentwicklung.
Durch die bewusste Berücksichtigung unterschiedlicher Ausgänge wird das Gehirn gezwungen, Alternativen durchzudenken und sich mit Konsequenzen auseinanderzusetzen. Dies ist auch hilfreich für:
- perfektionistische Menschen, die oft Entscheidungen vermeiden, um Fehler zu vermeiden.
- Menschen mit der Tendenz zur Übersteuerung, die sich zwischen Aktionismus und Lähmung bewegen.
- alle, die Initiative zu ergreifen lernen wollen, ohne sich dabei von Angst lähmen zu lassen.
Zudem wirkt diese Methode der negativen Rückkopplung entgegen, bei der man sich in Gedankenschleifen verliert, ohne zu einem Entschluss zu kommen.
So funktioniert die Worst-/Best-Case-Methode Schritt für Schritt:
1. Entscheidung identifizieren
Formuliere die konkrete Entscheidung, die ansteht – schriftlich. Beispiel: „Soll ich das Jobangebot in einer anderen Stadt annehmen?“
2. Worst-Case-Szenario entwerfen
Was wäre das negativste realistisch mögliche Ergebnis? Denke dabei an:
- emotionale Konsequenzen
- finanzielle Risiken
- Auswirkungen auf Beziehungen, Gesundheit etc.
Wichtig: Nicht dramatisieren bei der Analyse / Prognose, sondern realistisch kalkulieren. Eine Szenarioanalyse hilft, das Denkbare zu strukturieren.
3. Best-Case-Szenario entwerfen
Was ist das ideale Ergebnis? Was könnte im besten Fall daraus entstehen – in den gleichen Dimensionen: beruflich, privat, finanziell etc.
4. Optional: Realistisches Szenario entwickeln
Falls sinnvoll, entwerfe ein „mittleres Szenario“ – was passiert wahrscheinlich?
5. Wahrscheinlichkeiten einschätzen
Wie wahrscheinlich sind die Szenarien? Verteile z. B. 100 Punkte auf die drei möglichen Szenarien. So entwickelst du ein Gefühl für das realistischste Ergebnis.
6. Entscheidung abgleichen
Vergleiche: Kannst du mit dem Worst Case leben? Ist der Best Case attraktiv genug, um das Risiko unter den gewählten Annahmen einzugehen? Wenn ja: Entscheidung treffen.
Infoblatt zum Download: Worst case versus Best case
Methodische Einordnung: Zwischen Szenariotechnik und systemischem Denken
Die Worst-/Best-Case-Methode basiert auf der klassischen Szenariotechnik – einem Instrument, das auch in der strategischen Planung eingesetzt wird. Dabei geht es nicht um die Vorhersage der Zukunft, sondern um die gedankliche Vorbereitung auf mögliche Entwicklungen.
Sie entspricht in gewisser Weise dem systemischen Denken und Handeln: Entscheidungen werden nicht isoliert betrachtet, sondern im Kontext ihrer möglichen Auswirkungen – auch unter Berücksichtigung dessen, dass Systeme eine Eigendynamik entwickeln können.
Auch die Beratungsfähigkeit wird durch diese Technik geschult, da sie lehrt, komplexe Lagen strukturiert zu analysieren und verständlich zu kommunizieren. Siehe auch: Entscheidungshilfen.
Übungen zur Anwendung der Worst-/Best-Case-Methode
Übung 1: Tagesentscheidung analysieren
Nimm dir eine kleine Entscheidung des Tages (z. B. „Gehe ich heute zum Networking-Event?“) und skizziere in 5 Minuten Worst und Best Case. Entscheide danach bewusst.
Übung 2: Szenarien-Tagebuch
Führe über 2 Wochen ein Entscheidungs-Tagebuch. Notiere dir jeden Tag eine Entscheidung und die zugehörigen Szenarien. Reflektiere am Ende der Woche: Wie realistisch waren deine Annahmen?
Übung 3: Gruppenarbeit mit Szenariotechniken
In einem Team-Meeting oder Workshop: Wähle eine anstehende Entscheidung und entwickle gemeinsam verschiedene Szenarien. Diskutiert Wahrscheinlichkeiten und mögliche Strategien.

Fazit: Entscheidungskraft trainieren mit klaren Szenarien
Die Worst-Case-/Best-Case-Methode ist ein einfacher, aber äußerst effektiver Weg, um Entscheidungsfähigkeit zu fördern. Durch die Berücksichtigung von Extremszenarien entsteht emotionale Klarheit, Struktur und Fokus. So wird aus Unsicherheit Handlungsfähigkeit – ein echter Soft Skill für jede Lebenslage.