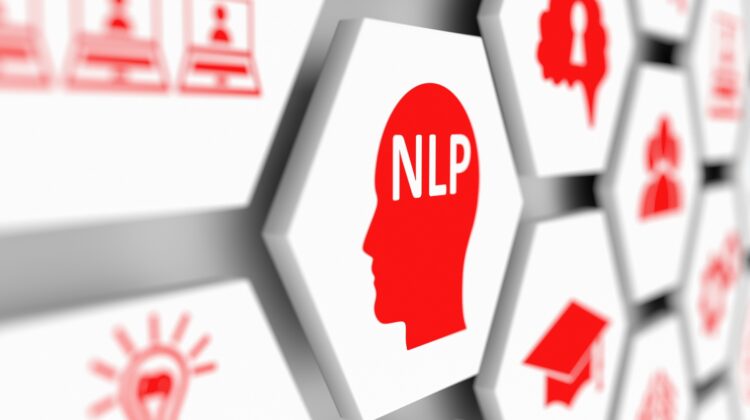
Formate, Techniken und Methoden im Neurolinguistischen Programmieren
Wenn Interessenten über das Neurolinguistischen Programmieren (NLP) recherchieren, werden die Begriffe „Formate„, „Techniken“ oder „Methoden“ im NLP fälschlicherweise oft als Synonyme verstanden. Diese Sichtweise ist aber nicht korrekt. Formate, Techniken und Methoden sind unterschiedliche Begriffe. Sie skizzieren verschiedene Konzepte, Ansätze und Maßnahmen im therapeutischen Prozess.
Allerdings sind zwischen Methode und Technik durchaus fließende Übergänge zu verzeichnen. Die Methode beschreibt ein Ziel. Dieses kann mithilfe verschiedener Techniken erreicht werden. Verschiedene Techniken können einer Methode folgen. Es können im NLP aber auch Techniken aus unterschiedlichen Methoden verwendet werden. Das macht das Neurolinguistische Programmieren im Einsatz in unterschiedlichen Feldern so vielseitig.
Mit Bezug auf das Auto, das für eine bestimmte Technik steht, wäre das Fahren die Methode, diese Technik zu bedienen. Die Methode alleine nützt niemandem etwas. Erst die Anwendung in Form einer oder mehrerer Techniken macht eine Methode sinnvoll. Auch im NLP verschwimmen Methoden und Techniken oft miteinander. Statt „Technik“ wird im NLP auch häufiger der Begriff „Strategie“ verwendet. Auch der Begriff „Verfahren“ könnte gelegentlich zur Anwendung kommen.
Unterschiede zwischen NLP-Formaten, Techniken und Methoden
Das „Ankern“ würde man als eine spezielle NLP-Technik beschreiben. Es handelt sich dabei weder um in Format, noch um eine Methode des NLP. Hingegen sind „Change History“ oder „Circle of Excellence“ als NLP-Formate zu verstehen. Bei einem NLP-Format handelt es sich um einen Überbegriff für die innerhalb dieses Konzeptes angewendeten Methoden und Techniken des NLP. Ein Format definiert bestimmte Arbeitsschritte für NLP-Techniken wie das „Six Step-Reframing“, die „Ankertechnik“ oder „Submodalitätstechniken“.
Während der vergangenen 40 Jahre wurden die anfangs von Bandler entwickelten Formate der NLP-Intervention nach und nach um einiges erweitert. Die Anfänge des NLP wurden auch in andere Bereiche – zum Beispiel in Coaching-Prozesse – übertragen. Das verlangte nach neuen Strategien. und Ansätzen. Ein komplexeres Format konnte auch aus dem Zusammenführen zweier einfacher NLP-Formate entstehen. Ein Beispiel ist die Reimprint-Technik. Sie ist im therapeutischen Prozess sehr effektiv.
Tatsächlich ist diese NLP-Methode eine Kombination aus mehreren NLP-Einzeltechniken. Sie enthält Elemente des „Pacings“, des „Rapports“, der „Kalibrierung“, des „Ankerns“, des „Hypnotalks“, der „Timeline“ und des „Reframings“. Selbst Meta-Modell-Fragen fließen mit ein. Der Grund für die Kombination von mehreren Techniken zu einer komplexeren Format-Version liegt in den alltäglichen NLP-Anwendungen. Bei komplexen Problemstellungen und Verhaltensmustern genügen einzelne Techniken häufig nicht, um dem therapeutischen Prozess gerecht zu werden.
Fortgeschrittene NLP-Praktizierende müssen daher in der Lage sein, die ihnen zur Verfügung stehenden Methoden und Techniken flexibel und situationsbezogen einzusetzen. Im Coaching-Prozess mit Führungskräften sind andere Strategien und Techniken sinnvoll als bei der Arbeit mit einem Angstpatienten.
Welche Formate sind im NLP bekannt?
1. Strategie-Arbeit
Unter dem Überbegriff (Format) der „Strategie-Arbeit“ versammeln sich das „Modelling“, das „Elizitieren“ von Strategien, der „New-Behavior-Generator“, die „Walt-Disney-Strategie“, die „Meta-Kognitions-Strategie“ und das „Charles Dickens-Format“.
2. Time-Line
Im Format der „Time-Line-Arbeit“ versammeln sich NLP-Techniken und Methoden wie die „Change History“, das „Re-Imprinting“, die „Verwirrung im Verstehen“, der „Belief im Zweifel“ oder der „Super Charger“. Hier wird bereits deutlich, dass viele Methoden und Techniken sehr eigenständige Bezeichnungen erhalten. Diese sind einem Laien nicht verständlich.
3. Wahrnehmungstechniken
Zum Format der „Wahrnehmungstechniken“ gehören die „Wahrnehmungs-Positionen-Technik“, die „Reinigung der Wahrnehmungs-Positionen“, die Arbeit mit „Submodalitäten“, die „Swish“-Technik und „Kritik im Feedback“.
4. Zielfindung
Dem Format der „Zielfindung“ werden Techniken und Strategien wie das „NLP-Ziele-Format“, das „Meta-Modell“, das „Pene-TRANCE-Modell“ und die „Zeit-Progression“ zugeordnet.
5. Ankertechniken
Das Format des „Ankerns“ umfasst eine ganze Reihe von NLP-Strategien und Techniken, beispielsweise den „Moment of Excellence“, den „Moment of Importance“, den „Circle of Excellence“, die Methoden des Anker Verschmelzens, Verkettens oder Stapelns, den „gleitenden Anker“, das „Vitamin R“ und die „Mentoren-Technik“.
6. Reframing
Dem „Reframing“ werden das „Alignment“, das „Verhandlungs-Reframing“ oder der „Visual Squash“, das genau festgelegte „Six-Step-Reframing“ und der „Identy-Process“ zugeordnet. Siehe auch: Was bedeutet Reframing?
7. State-Management
Das Format des „State-Management“ enthält diverse Strategien und Techniken. Es umfasst:
- die Core-Transformation 1 sowie das Core-Outcome
- die Core-Transformation 2 (aufwachen lassen)
- die Core-Transformation 3 mit dem Eltern-Re-Imprinting
- die Psychogeografie und die Du-Botschaften
- „Bandlers Puma“
- den „Meta-Mirror“
- das Double-Bind-Modell
- die „Versagen im Feedback“-Technik
- dass bereits bekannte „Time-Line-Reframing“
- das Re-Anchoring
- die „Drug of Choice“
- und die Phobie-Technik.
8. Werte
Unter dem Format der Werte ist dafür momentan lediglich die „Werte- und Kriterien-Hierarchie-Technik“ enthalten.
9. Glaubenssätze und logische Ebenen
Das Format „Glaubenssätze und logische Ebenen“ ist wieder umfangreicher. Es umfasst die Erforschung der „Glaubenssatz-Ausdehnung“, das „K.A.S.I.G-Modell“, die „Diamond-Technik“, den „Glaubenssatz-Zirkel“, die „Time-Line-Belief“-Integration, das „Sleight-of-Mouth-Pattern“ und das bereits an anderer Stelle erwähnte „Re-Imprinting“. Siehe auch: Glaubenssätze auflösen.
10. Team-Modelle
Unter das Format der „Team-Modelle“ werden Teambildungs-Prozesse, das „Teamkaleidoskop“ und der „Leonardo da Vinci“-Prozess einsortiert.
11. Paar-Modelle
Bei den NLP-Paar-Modellen finden sich Methoden und Techniken wie „Re-Anchoring-Couples“, „Reframing-Couples“ und eine „Kleine Schule des Wünschens“. Hier wird auch ohne tiefere Kenntnis der NLP-Methoden deutlich, dass diese der therapeutischen Situation angepasst werden können. Vor allem die Ankertechniken oder das Reframing erweisen sich als vielseitig einsetzbar.

Welches sind die wichtigsten NLP-Techniken und -Methoden?
Vieles, was im NLP mit einem deskriptiv klingenden Titel versehen wird, ist für einen Laien nicht sofort verständlich. Auch die verständlicheren Bezeichnungen von NLP-Techniken sind nicht immer selbsterklärend. Sie verweisen auf ganz eigene Sichtweisen und Konzepte. Daher hier ein Überblick über die wichtigsten Techniken aus dem reichhaltigen NLP-Universum. Oftmals wird bei NLP-Techniken und Methoden der Weg zu einem Ziel exakt vorgeschrieben.
1. Das Energiefeld
Thema ist die bewusste Wahrnehmung der eigenen Ausstrahlung und die Beeinflussung dessen, was man wahrnimmt. Die fünf Sinne sollen dabei genutzt werden. Der Klient soll sich ein Energiefeld vorstellen, das er wie einen „Magischen Kreis“ betreten und verlassen kann. Zunächst wird der magische Kreis in der eigenen Vorstellung aufgebaut. Dann betritt der Klient ihn und schildert seine Wahrnehmungen. Wenn er wieder hinaustritt, soll er einen „Ökologie-Check“ durch den „Future Pace“ vornehmen. Er soll das Energiefeld zum Anker machen und mitnehmen.
Bei der NLP-Technik „Kreis der persönlichen Exzellenz“ soll der Klient sich an besonders herausragende Lebensmomente erinnern. Er soll in seiner Vorstellung den „Kreis der Exzellenz“ aufbauen und hineintreten. Das Gefühl soll er auskosten und genießen. Er soll auf Assoziationen dazu achten, und anschließend wieder hinaustreten. Erneut wird der „Ökologiecheck über den Future Pace“ vorgenommen. Das positive Erlebnis wird auch hier als Anker mitgenommen.
2. Der SCORE
Der Begriff SCORE setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Begriffe Symptom, Cause, Outcome, Resource und Effect zusammen. Die Technik des SCORES stellt sicher, dass der Therapeut alle notwendigen Informationen bekam, um eine passende NLP-Technik einsetzen zu können. Genutzt werden in SCORE-Erkundungen NLP-Techniken wie „Backtrack“, „nonverbale Zustimmung“ und „Hinterfragen von Inkongruenzen“.
3. Die 1.2.3.Position
Ziel dieser NLP-Technik ist ein erhöhtes Verständnis. Außerdem sollen für den Klienten mehr Flexibilität und Wahlfreiheit durch das Erkennen einer Perspektivenvielfalt erreicht werden. Der Klient soll aus einer gedachten ersten Position heraus über seine sinnlichen Wahrnehmungen zu einer zweiten Position kommen. Er kann anschließend noch andere Positionen einnehmen. Dabei kann er jede Position auf Vor- und Nachteile, eigene Absichten und Ziele untersuchen. In der dritten Position soll der Klient die besprochene Situation aus größerem Abstand betrachten. Die gesammelten Erkenntnisse sollen nun in Position eins einfließen. Diese wird damit erweitert. Siehe auch: Stressimpfungstraining – Meichenbaum Methode.
4. Rapport
Der NLP-Praktizierende soll sich durch einen „Rapport“, kombiniert mit den NLP-Techniken „Pacen“ und „Leaden“ auf die Körpersprache des Klienten konzentrieren. Ziel ist es, sich in den Gesprächspartner hineinzuversetzen. Dieser soll spüren können, dass er verstanden wird. Das „Pacen“ kennzeichnet so gesehen ein Mitgehen mit dem Klienten. Man bemüht sich, mit ihm Schritt zu halten.
Das „Leaden“ dient dann dazu, den Zustand des Klienten mit gezielten Interventionen zu verändern (vgl. auch Separator im NLP). Beispielsweise kann der Therapeut bei Inkongruenzen eine nonverbale Spiegelung über Mimik oder Gestik vornehmen. Er kann die Inkongruenz im Anschluss verbal spiegeln. Er fragt den Klienten außerdem nach jeder Intervention, ob dieser zum Thema noch etwas berücksichtigt haben wolle.
5. VAK Pacen, Leaden oder Übersetzen
Das Kürzel „VAK“ steht im NLP für das Heraushören visueller, auditiver und kinästhetischer Formulierungen und Satzwendungen. Der Therapeut soll nach Möglichkeit auf die gleiche Weise antworten, sich also in der Kommunikation an den präferierten Sinneskanälen respektive Repräsentationssystemen des Klienten bzw. Gesprächspartners orientieren. Falls es bei weiteren Gesprächspartnern deswegen in der Kommunikation zu Missverständnissen kommen würde, soll er das Gesagte im Gespräch „übersetzen“.
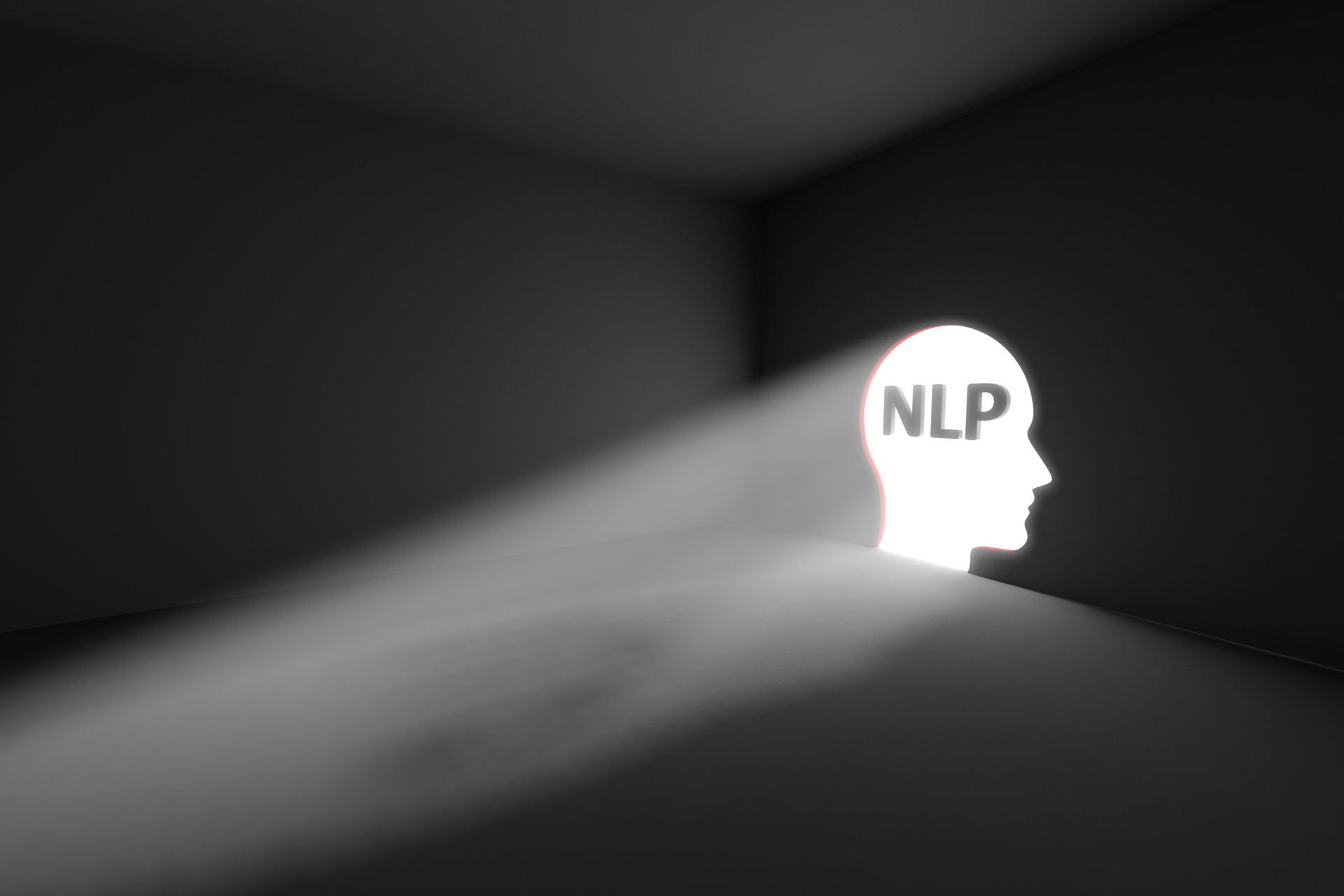
6. Chunking
Für diese Technik sind drei Richtungen nutzbar: das „Chunk down“ oder Herunterchunken, das „Chunk up“ bzw. Hochchunken und das „Chunk sideways“, bei dem das Erfragen von Assoziationen im Gespräch Thema ist. Ziel des „Chunk downs“ ist es, präzisere Formulierungen zu erfragen. Ziel des Hoch-Chunkens ist es, unangemessene Ziele zu hinterfragen. Ziel des „Chunk sideways“ ist es, in Smalltalk-Form nach Assoziationen zu fragen. Die Technik des Chunkens kann vielseitig in der Kommunikation eingesetzt werden. Um bestimmte Ziele zu erreichen, können zusätzlich NLP-Techniken wie der „New Behavior“-Generator oder die „Logischen Ebenen“ eingesetzt werden.
7. NLP SMART
Auch der Begriff SMART besteht aus den Anfangsbuchstaben einiger NLP-Begrifflichkeiten. Es geht um eine situationsspezifische Vorstellung des gerade erreichten Zieles, um messbare Ergebnisse bzw. empfundene Meilensteine. Das A in SMART steht für eine attraktive Zielvorstellung mit sinnlichen Komponenten. Das R in SMART steht für realistische Ziele, die der Klient erreichen und aufrechterhalten kann – und das T steht für „terminiert“.
NLP SMART dient dazu, Ziele und Visionen zu entwickeln und persönliche Meilensteine zu klären. Das kann mit der Technik des Chunkens geleistet werden. Professionelle NLP-Praktizierende achten darauf, gegebenenfalls gesetzte Ziele zu verändern und durch den Einsatz von Techniken wie „Future Pace“ und „Ökologie-Check“ zu klären.
8. New Behavior-Generator
Dieser „Generator“ soll den Klienten mental darauf vorbereiten, sich neue Verhaltensweisen anzueignen. Der Klient lernt, sich im Selbstgespräch mit neuen Verhaltensweisen sowie den dahinterstehenden Werten und Überzeugungen zu befassen. Er soll sich dann vorstellen, in einer konkreten Situation entsprechend zu handeln. Der Klient steigt zunächst nur in die imaginierte Situation ein. Er genießt sie und fragt sich am Schluss, ob das Ergebnis wünschenswert war oder Änderungen Sinn machen würden.
9. Logische Ebenen
Die „Logischen Ebenen“ dienen der Aktivierung von Zielen eines Menschen. Genutzt werden dafür sogenannte „Bodenanker“. Der Klient soll sich zunächst eine Umgebung vorstellen, in der er seine Ziele erreichen möchte. Dann stellt er sich das dort angewendete Verhalten vor. Er imaginiert die Fähigkeiten, Werte und Überzeugungen, die ihn bei seiner Zielsetzung unterstützen und tragen können. Er stellt sich vor, wie er sich dabei fühlt. Er imaginiert, genau die Art von Mensch zu sein, die solche Ziele erreichen kann. Er stellt sich die sozialen Beziehungen vor, die sich aus einer imaginierten Verhaltensweise ergeben könnten.
Zum Abschluss der Logischen Ebenen befasst der Klient sich mit einer Vision, in die sein Ziel eingebettet wird. Dabei können die NLP-Techniken des „Chunk up“ und „Chunk sideways“ eingesetzt werden. Die Logischen Ebenen eignen sich zur Vertiefung von Gesprächen, weil man durch sie sämtliche Ebenen eines Themas erforschen und verstehen kann.
10. Change History
Die eigene Geschichte ist oft konfliktreich. Mit der NLP-Technik „Change History“ kann innerer Frieden erreicht werden. Das „Innere Kind“ des Klienten wird hier zum Thema gemacht. Seine Konflikte werden besprochen und gelöst.
Alte Konflikte sind oft an Situationen in der Gegenwart beteiligt. Die Klienten erkennen, dass ihre Reaktionen unangemessen sind. Ein Problem-Anker wird genutzt, um den Klienten in seine Vergangenheit zurückzuführen. Dort soll er sein Inneres Kind ansprechen. Er soll ihm alles geben, was es braucht, um inneren Frieden und Trost zu finden. Der Klient wird quasi zum besten Freund des Inneren Kindes. In der Folge soll das unglückliche Innere Kind nicht mehr die Reaktionen des Klienten im Hier und Jetzt beeinflussen.
11. Visual Squash
Beim „Visual Squash“ ist das Thema ein innerer Konflikt, dessen Lösung schwerfällt. Der Grund für den Mangel an Lösungsansätzen sind zwei offensichtlich unvereinbare Interessen. Mit Hilfe der Sinne stellt der Klient sich nun vor, dass auf einer Hand der eine Konfliktteil, auf der anderen der andere Platz nimmt. Beide Seiten stellen nun im Dialog miteinander dar, was ihre Interessen und positiven Absichten sind. Jeder soll dann die Absichten seines Gegenübers würdigen. Anschließend soll eine Kompromisslösung gefunden werden. Die guten Absichten beider Interessen sollen dabei berücksichtigt werden. Als Symbol für die Einigung auf eine Lösung werden am Schluss die Hände zusammengelegt.
12. Six-Step-Reframing
In diesem sechsstufigen Reframing-Prozess soll ein Persönlichkeitsanteil des Klienten dabei unterstützt werden, neue Handlungsalternativen für seine positiven Absichten zu finden. Die sechs Schritte dafür sind genau vorgegeben.
Zunächst wird das Problem abgeklärt. Dann kommuniziert der Klient mit dem Therapeuten über das Problem. Der Therapeut nutzt die Kommunikation mit dem Unbewussten, um körpersprachliche Zeichen wahrzunehmen. Dem schließt sich die Erforschung der positiven Absichten hinter einem bestimmten Verhalten an.
Nun sollen mindesten drei neue Verhaltensweisen ermittelt werden. Diese sollen im Einklang mit dem bisherigen Prozess stehen. Danach folgen ein „Ökologie-Check“ und der „Future Pace“. Der Therapeut sucht nach Anzeichen für die Verantwortungsübernahme des Klienten.
13. Submodalitätentransfer
Thematisiert wird hier, dass Gefühle nicht abhängig von den Inhalten innerer Vorstellungen oder Bilder sind. Vielmehr beziehen Gefühle sich meist auf sogenannte „Submodalitäten“, also die Neben- und Untereigenschaften der inneren Bilder. Positive innere Bilder verursachen meist eine gute Stimmung. Ihre nicht bewusst wahrgenommenen Submodalitäten können jedoch bei der Erforschung auf die Vorstellungen/Bilder mit übertragen werden. Als Folge kippt die Stimmung. Der Prozess des bewussten Erforschens verschiedener innerer Bilder setzt einen Lernprozess im Gehirn in Gang.
14. Swish
Mit dieser Technik soll der Klient mit einem definierten Auslöser veränderte Abfolgen von inneren Bildern erzeugen. Dazu wird eine bestimmte Schrittfolge eingehalten. Der Therapeut assoziiert ein Problemauslösebild. Der Klient verhält sich zu Beginn wie gewohnt. Er sieht das Problem aus seinem Blickwinkel. Dann soll er das innere Bild verändern. Er soll es heller, dunkler, kleiner oder größer machen. Die Reaktion darauf wird gecheckt.
Nun wird ein dissoziiertes Ziel-Bild etabliert. Jede Veränderung dieses Bildes soll dabei eine veränderte Reaktion ergeben. Im Ökologie-Check wird das Gehirn befragt, ob es die Bereitschaft zeigt, den Klienten bei den angestrebten Veränderungen im Verhalten zu unterstützen.
Das assoziierte Problembild wird nun schnell (wie mit einem Swish auf dem Smartphone) hin und her gewechselt. Zugleich soll sich der Klient das dissoziierte Ziel-Bild in angenehmer Weise vorstellen und es genießen. Dieser Vorgang wird mehrfach wiederholt. Dann wird ein Test unter realen Bedingungen durchgeführt.
15. Die Fast-Phobia-Technik
Viele Menschen tragen angstauslösende Bilder im Kopf. Diese NLP-Technik dient dazu, diese Bilder zu neutralisieren. Dazu sollen die Klienten sich in einen gedachten Kinosaal versetzen. Sie sollen sich dort hinsetzen und sich auf der Leinwand ein Bild von der angstmachenden Situation vorstellen – aber einen Moment, bevor die Angst zuschlug. Das ist noch eine von der Angst dissoziierte Situation. Nun sollen die Klienten sich vorstellen, sie schweben durch den Vorführraum und sehen sich selbst im Zuschauerraum sitzen. Auch das eine von der Angst dissoziierte Situation.
Jetzt soll das Bild schwarz-weiß werden. Die angstauslösende Situation soll vom Vorführraum aus in schwarz-weiß angesehen werden. Auch die Angst soll so betrachtet werden. Wenn alles ausgestanden ist, soll der Klient sich wieder in die Person im Saal hineinversetzen. Er betrachtet nun dieselbe Situation von dieser Warte aus, aber in Farbe. Dann geht er mit dem Blick zurück nochmals durch dieselbe Situation – aber rückwärts.
Anschließend wird dieser Prozess unter verschiedenen Vorzeichen mehrfach wiederholt. Nur das Tempo der imaginierten Vorführungen zieht an. Schließlich wird eine reale Situation, die Angst macht, als Test durchgeführt.
16. Die Meta-Modell-Fragetechnik
Durch das Hinterfragen hinderlicher Überzeugungen, Einstellungen und Sichtweisen sollen Denken, Wahrnehmung und Gefühle verändert werden. Hinderliche Stereotypen, gewohnheitsmäßige Verallgemeinerungen, inhaltliche Verzerrungen und sogenannte „Tilgungen“ werden durch Meta-Modell-Fragen ermittelt.
Unter den Strategien des Klienten finden sich sogenannte „Universal-Quantoren“, also Verallgemeinerungen. Außerdem Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, Modaloperatoren oder bezugslose Bewertungen. Oft bedienen sich Klienten zudem Vergleichen, die gar keinen Bezug zur erlebten Situation haben. Sie benutzen unspezifische Verben oder Substantive.
Solche Wendungen können durch fragende Wiederholung, Gegenbeispiele, Übertreibungen, ironische oder persiflierende Anmerkungen oder Fragen entlarvt werden.
Youtube-Video: 10 machtvolle NLP Techniken, die jeder kennen sollte
17. TimeLine zur Aktivierung von Ressourcen
Eine vorgestellte „TimeLine“ soll Verbindungen zwischen eigenen Ressourcen und den angepeilten Zielen des Klienten herstellen. Diese NLP-Technik ist bei vielen NLP-Einsätzen nutzbar.
Der Klient soll Schritt für Schritt vorgehen. Er soll sich zunächst ein SMARTes Ziel vorstellen. Dann soll er seinem Körper entschweben. Er soll in einem aushaltbaren Abstand über seiner Zeitlinie schweben. Er soll dann sein Ziel auf der Zeitlinie an der korrekten Stelle als erreicht markieren. Danach sucht er die Zeitlinie nach Ressourcen ab, die diesen Erfolg ermöglichen könnten. Mit jeder ermittelten Ressource soll er sich intensiv verbinden.
Es wird nun eine farbige Verbindungslinie zwischen der Ressource und dem angepeilten Ziel imaginiert. Außerdem soll die Zeitlinie an dieser Stelle eine bestimmte Temperatur und einen überzeugenden Satz erhalten. Der Klient soll die Veränderung der Energie auf der Zeitlinie erspüren, während er in seiner Vorstellung über dieser schwebt. Dann soll er zum gedachten Zielpunkt schweben und auch dort die aus den Ressourcen stammende Energie erfahren.
18. Anker mit Augenbewegungen verschmelzen
Fließende Bewegungen mit den Augen können eingesetzt werden, um das Gehirn zu einer Problemlösung zu bringen. Diese NLP-Technik ist auch als „Collapsing Anker“-Form bekannt.
Der Klienten soll von einem Problem berichten. Damit ist ein Problem-Anker etabliert. Er soll gleichzeitig mit den Augen fließenden Bewegungen folgen, die der NLP-Therapeut mit seinen Fingern ausführt. Damit wird der Ressourcen-Anker etabliert. Im Weiteren soll es zu einer Verschmelzung dieser beiden Anker kommen. Damit werden plötzlich neue Lösungsansätze denkbar.
Der NLP-Therapeut sollte bei der Intervention auf bestimmte nonverbale Reaktionen achten. Bemerkt er diese, kann er den Klienten bitten, die Augen zu schließen. Er soll nun herausfinden, was gerade in ihm vorgeht.
Ähnliche Vorgehensweisen sind bei der „Eye Movement Integration“ (EMI), beim „Eye Movement Desensitization and Reprocessing“ (EMDR) und beim „WingWave-Coaching“ im Einsatz.
19. Die Disney-Strategie
Hier werden Realität und Traum mit konstruktiver Kritik verbunden. Auch bei dieser NLP-Technik wird eine klare Schrittfolge beachtet. Vier Disney-Räume werden mit einem Bodenanker aufgeladen. Anwesend sind der Träumer, der Realist und ein liebevoller Kritiker. Außerdem gibt es einen Meta-Raum, der distanzierte Betrachtungen von außen ermöglicht. (Vgl. auch: Kreative Problem-Lösung mit Denkstühlen nach Walt Disney)
Nun wird die Beziehung der Räume zueinander überprüft und gegebenenfalls angepasst. Das Projekt des Klienten durchläuft alle Räume. Es wird von allen Seiten begutachtet. Dann wird diese Betrachtung auf der Meta-Ebene überprüft. Es folgt ein Schnelldurchlauf samt erneuter Meta-Kontrolle. Danach folgen ein Öko-Check und ein Future Pace.
